Poiana Micului heute
Aus: Katholischer Volks- und Hauskalender für die Bucovina
(Czernowitz: 1939): 117-127
Veröffentlicht 23 März 2004
Wir fahren mit der Eisenbahn oder mit dem Überlandauto bis Gurahumorului, dem am Zusammenfluss der Moldova und Humora gelegenen Städtchen. Noch 21 Kilometer trennen uns von Poiana Micului, wo wir unseren deutsch-böhmischen Landsleuten einen Besuch machen wollen. Die vor dem Kriege ins Tal der Humora führende Waldbahn wurde von den Russen abgerissen und ist seither nicht wieder ausgebaut worden. So sind wir auf den Pferdewagen oder auf unsere Füsse allein angewiesen. Die Fahrstrasse führt uns immer dem anfangs breiten und windungsreichen Flussbett der Humora entlang, durch Mánástirea Humorului hindurch, wo die vier Jahrhunderte alte rumänische Klosterkirche unsere Bewunderung erregt, immer weiter in das sich langsam verengende Tal der Humora hinauf, bis man nach fast 15 km Wanderung auf die ersten Häuser des slowakeischen Teiles von Poiana Micului trifft.
Die Berge Sind nun ganz nahe an das munter zu Tal hüpfende Bergwasser herangetreten; an den Halden lehnen überall die Gehöfte der Slowaken, Kinder grüssen freundlich, und Erwachsene schauen hinter Fenstervorhängen dem Fremdling nach. Wieder hat das Tal in weitem Winkel seine Richtung verändert, da taucht auf einmal die milchweisse Pfarrkirche mit dem gegenüberliegenden neuen Pfarrhause vor unseren Augen auf. Eine ganze Stunde mussten wir wandern, um vom Eingang des Dorfes die Kirche zu erreichen. Jenseits der Kirche das Tal hinauf stossen wir nur noch auf deutsche Siedlerhäuser. Freundlich grüssen die Leute, saubere Häuser stehen auf beiden Seiten der Strasse, dahinter dehnen sich bis hoch zum Wald hinauf die Felder und Wiesen unserer Deutschböhmen. Nach weiteren drei Kilometer sind wir am Ende der menschlichen Siedlungen. Der Wald dehnt sich in ungeheuerer Weite aus, die Halden hinauf, über die Berge, soweit das Auge reicht — nichts als Wald. Sieben Kilometer lang ist das Dorf, aber von der Talsohle an gemessen nicht ein Kilometer breit. Das ist Poiana Micului, der Ort, der auf dem Boden steht, den vor 100 Jahren noch undurchdringlicher Urwald bedeckte.
Vor hundert Jahren
Im Jahre 1838 machten sich drüben in den böhmischen Landen viele Familien für eine weite Reise fertig. Der Kaiser will die Waldtäler der Bukowina mit Böhmerwäldlern besiedeln. Viele folgten dem Werberuf; der sie zwar nicht ausserhalb des damaligen Kaiserreiches, aber doch weit nach dem Osten führen sollte. Was sie nicht mitnehmen konnten, verkauften die vielfach armen Häusler. Nur das Allernotwendigste, etwas Hausrat, Kleider, Wäsche, einige religiöse Wandbilder, ein Kruzifix und von Ahnen ererbte Gebetbücher, wurde auf ein Wägelchen verfrachtet, das in den meisten Fällen von den Auswanderern selber gezogen werden musste. Manche besassen Hunde, die sie als Zugtiere vorspannten. Ein einziger nur von denen, die nach Poiana Micului wanderten, besass ein Pferdegespann. Reisepass, Taufscheine und andere Urkunden wurden zusammen mit dem vom Verkauf gelösten Geld sorgsam in den Taschen verwahrt; wehmutsvoller Abschied von den Verwandten ward gefeiert. Die wenigsten sollten sich ja auf dieser Welt noch einmal sehen.
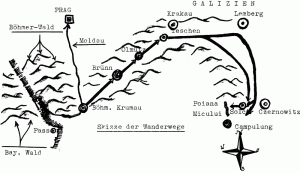
Dann gings fort von Ort zu Ort, quer durch das Gebiet, der heutigen Tschechoslowakei. Budweiss, Iglau, Brünn, Olmütz, Teschen wurden berührt. Man meldete sich in den Städten bei den Behörden, liess sich auf den Reisepass einen Stempel aufdrücken und zog weiter gegen Galizien zu. Oben im Norden lag Krakau, die Stadt, die der Nürnberger Meister Stoss Veit so herrlich mit dem Dom schmückte, die Stadt, die schon im Jahre 1257 deutsches Stadtrecht erhielt. Viel deutsches Blut war in diesen Gegenden seit dem Mittelalter im Polentum untergegangen, das von der Ostbesiedlung allein den Nutzen zog. Auf Galiziens bald staubigen, bald vom Regen aufgeweichten Landstrassen zogen unsere Deutschböhmen dahin, hinein in die weite, für das deutsche Auge, und besonders für den Wäldler, so trostlose Gegend, wo nur selten ein kleiner Hügel oder ein Stück Wald das Auge des Reisenden erfreut. Acht bittere Wochen vergingen, bis die Wanderer in der Bukowina ankamen. In Radauti, Clit und Solca warteten sie, bis der kaiserliche Verwalter ihnen Grund und Buden anwies. Sie mussten leider viele Monate ausharren uni ihr Leben mühsam durch Taglöhnerarbeit fristen. Man hatte viel versprochen, aber wenig gehalten. Auf das öftere Drängen und Mahnen der Siedler beim staatlichen Verwalter Koch im Solca, nun endlich das versprochene Land anzuweisen, hatte dieser nur das Wort übrig: „Der Himmel ist hoch, der Kaiser ist weit, und hier bin ich Herr.”
Den Deutschböhmen wies man dann endlich das weltabgelegene Urwaldgebiet im hinteren Humoratal an. Unsere Siedler mussten ganz von vorne anfangen.
Um wie viel besser ging es achtzig Jahre vorher unter Kaiser Josef den Ansiedlern in Galizien! Dort wurde im allgemeinen alles vorbereitet. Die Siedler brauchten nur kommen und sich in die fertigen Häuser setzen. Sogar die Inneneinrichtung fehlte nicht, Ackergeräte standen zur Verfügung. Vieh war da, bebaubares Land ringsum. Kein Wunder, dass die Leute heute noch sagen: „der Kaiser hat uns sogar die Löffel gegeben.” So wie damals um die Mitte des 18. Jahrhunderts war niemals mehr eine staatliche Besiedlung vorbereitet und gefördert worden. Die Deutschböhmen bekamen nur das Land – und das war Urwald. Nicht ein Flecken bebaubarer Boden war zu sehen. Erst musste der Wald an den Talhängen fallen, und das kostete eine Riesenarbeit. Ein anderes Volk hätte die Strapazen nicht ertragen. Man wusste vonseiten der Behörden genau, warum man gerade die Deutschböhmen in diese Gebiete gerufen. Die Schwaben hätten sich nie da niedergelassen. Sie kamen aus einem schon überzivilisierten Gebiet Deutschlands und stellten daher an das Leben schon grössere Anforderungen.
Tief drin im Böhmerwald
Böhmen, die Heimat unserer Einwanderer aber war Deutschlands jüngstes Siedlungsgebiet. Erst im 14. Jahrhundert wurde es durch bayrische Kolonisten, erschlossen. Noch bis zum Jahre 1870 gab es im Böhmerwald weite Bestände die nie eine Axt berührt hatte. Vielhundertjährige Stämme standen in den unzugänglichen Waldungen, die jeder Nutzung unzugänglich waren. Nur ganz langsam drangen die Menschen aus den tiefer gelegenen Teilen in die Wildnis vor. Nicht die Landwirtschaft besiegte den Wald, sondern Holzschlag und Glashüttenbetrieb. Holzfäller, Köhler und Aschenbrenner waren die Vorboten menschlicher Kultur. So wuchs im Böhmerwald im Kampf mit der Wildnis ein einfaches und hartes Geschlecht heran. Keine Paläste, keine grossen Höfe, sondern einfache Blockhütten waren die Wohnungen der Böhmerwäldler. Nach und nach gelang es ihnen, dem Wald den Boden abzuringen. Aus vielen Holzfällern wurden Kleinbauern. Städtisches Wesen und Zivilisation kannten die Wäldler nicht. Einfach wie ihre Lebensweise, war auch ihr Denken.
So waren die Deutschböhmen die richtigen Menschen zur Kolonisation der Bukowina. Sie kamen aus dem Wald und gingen wieder in den Wald. Er gehört zu ihnen wie der Schatten zum Licht.
Die Besiedlung
Im Jahre 1838 wurde also diesen Deutschböhmen das Land zugewiesen: Die eigentliche Gründung der Gemeinde erfolgte jedoch erst im Jahre 1842. Gleichzeitig mit den Deutschböhmen kamen aus Oberungarn Slowaken in das Humoratal. Sie halfen mit, die Gemeinde Poiana Micului gründen und bewohnen den vorderen. Teil des Dorfes.
Unsere Deutschböhmen kamen nach ihren eigenen von den Einwanderern her überlieferten Angaben aus folgenden Orten Böhmens: Zottelberg, Schinhofen, Aussergefild, Rehberg, Grünberger Hütte, Roteisenburg, Welischbürgen, Sass und Schneewiesen. Eine Familie namens Fiber stammte aus Bayern. Sie hielt es jedoch in dem rauhen Waldtal nicht lange aus und zog wieder weiter. Der erste, der sich im Gebiet der heutigen Gemeinde niederliess, war Jokl Kisslinger. Als er ankam, baute er sich eine notdürftige Hütte auf einer kleinen Waldwiese. Noch heute nennt man jenen Flecken die „Joklhütten.”
Hier seien nun die Namen der Ansiedler nach den Angaben des noch leben den, 86 Jahre alten Wenzel Hackl angegeben: Stefan Honers, Andreas Klostermann, Leopold Schuster, Anton Beer, Georg Hofmann, Andreas Lang, Johann Beutel, Adam Herzer, Georg Neuburger, Josef Flachs, Wenzel Reitmajer, Josef Lang, Georg Hellinger, Ignaz Rankl, Andreas Hartinger, Josef Weber, Johann Hable, Andreas Lang, Günther Stör, Andreas Weber, Karl Reitmajer, Josef Heiden, Mathias Eigner, David Fiber, Georg Binder, Wenzel Rach, Anton Tischler, Franz Schelbauer, Josef Lang, Andreas Winzinger, Mathias Fuchs, Wenzel Kisslinger, Martin Reitmajer, Jakob Kufner, Anton Landauer, Sebastian Baumgartner, Josef Lang, Wenzel Hackl (Vater des noch lebenden 86 Jahre alten W. H.) Stefan Schuster, Johann Fuchs, Adalbert Fuchs und Josef Buganiuc (Slowake). Zusammen waren es also 42 Familien im deutschen Teil des Dorfes.
Wälder fallen
Nun ging es an die Arbeit. Gewaltige Rauchschwaden stiegen in den ersten Jahren aus dem Urwald des hinteren Humoratales. Jahrhundertalte Baumstämme frass das von den Siedlern entfachte Feuer hinweg. Ohne bebaungsfähigen Boden ist kein menschliches Leben möglich. Und Boden brauchten die Siedler. Darum gingen sie schonungslos gegen den Wald vor. Die gewonnene Asche verkaufte man an benachbarte Glashütten. Noch oft haben die Siedler es später bereut, dass sie so viel Holzwerte zerstört hatten. Aber es ging wohl nichts anders. Abtransportieren konnte man das Holz nicht. Es fehlte an Fuhrwerken, Pferden, an Wegen – nach Gurahumorului führte nur ein Fussteig, der 18 Mal das Wasser überquerte — und es mangelte vor allem an Käufern. So waren die Umstände stärker als menschliches Wollen und Kraft.
Der Urwald barg in seinen Tiefen ein üppiges Tierleben. Füchse und Rehe gab es in Fülle, und das Brüllen der Hirsche erschütterte die Einsamkeit der neuen Siedlung. Die Holzhauer stiessen in den dichten Waldungen auf Luchse, und dann und wann auf einen Bären. Im Winter trieben die Wölfe ihr Unwesen. Alte Leute wissen nach zu erzählen, dass in einer Nacht ganz in der Nähe des Dorfes 14 Hirsche von Wölfen zerrissen wurden. Und die Wölfe, denen die menschlichen Wohnungen etwas neues waren, besuchten des Nachts oft die Gehöfte und sollen sogar zu den Fenstern hineingeschaut haben. „Oft heulten sie, dass man meinte, eine Musikkapelle spiele im Wald”. Im Humorabach wimmelte es von Forellen. Die alten Leute erzählten, dass man sie nicht fing, sondern totschlug.
Hartes Leben
Langsam erstanden nun an den gerodeten Stellen die ersten Blockhäuser. Die Bauart war denkbar einfach. Ein Zimmer, eine Kammer, ein kleiner Stall, das war die ganze Einrichtung. Im Zimmer bereitete die Hausfrau die Speisen. In der warmen Jahreszeit ward die Küche in den Hof verlegt. Nach böhmischer Art baute man den Backofen unter den Kamin. Das Dach des Siedlerhauses war oft ein sog. Walmdach, bei dem auch die Schmalseiten schräg – nicht steil wie beim Satteldach – abfallen. Der Wald lieferte Holz genug für die Schindeln, mit denen bis zum heutigen Tag fast alle Häuser der Siedlung gedeckt sind.
Die Regierung stellte den Kolonisten zunächst aus der Moldau bezogenes Vieh zur Verfügung, das später durch eine hochwertigere Rasse aus den österreichischen Landen ersetzt wurde. Das Feld lieferte Kartoffel, Korn und Flachs, in den Gärten pflanzte man das notwendigste Gemüse. Der Kukuruz jedoch, den die Deutschböhmen erst in der Bukowina kennen lernten, gedieh in dem frischen Waldtal nicht. Wenn man mit den ältesten Leuten des Ortes spricht, so geht aus all ihrem Erzählen immer wieder das eine hervor: Die ersten Jahre waren eine furchtbare Notzeit. Gesuche an den Kaiser im Jahre 1847 und 1848 bezeugen die jammervolle Lage der Siedler. Das Jahr 1846 war ein Missjahr. Die Kartoffel verfaulten auf den Äckern durch den lang anhaltenden Regen, die Siedler mussten zu alledem noch Steuern zahlen. Sie waren nicht, wie viele andere Gemeinden, die ersten Jahre steuerfrei. Grosse Sorge machte den armen Kolonisten die Erhaltung einer militärischen Grenzwache. Am Schlusse ihres ungemein flehentlich gehaltenen Gesuches erbitten die Deutschböhmen um die Entsendung einer unparteiischen Kommission, die die Hilfsbedürftigkeit der Gemeinde untersuchen solle.
Die Deutschböhmen mussten wenig in dem neuen Lebensraum dazulernen. Alles war, nachdem einmal die Häuser standen, ähnlich wie zu Hause in Böhmen. Fast jeder Siedler war auch Handwerker. Er verstand den Hausbau, machte sich seine Schuhe selber aus Ahornholz, verfertigte Holzschüsseln und Löffel, die Hausfrau spann mit ihren Töchtern den selbst angebauten Flachs, und der Mann konnte mit dem selbst gezimmerten Webstuhl umgehen. In den langen Winterabenden trafen sich einzelne Gruppen mit den „Radeln und Rupfen”. Da waren dann Mund und Hände eifrig an der Arbeit. “Das Licht lieferten Buchenspähne, die vorher im Ofen gut getrocknet worden waren. Später spendeten Unschlittlichter die Helligkeit, bis schliesslich das Petroleum seinen Siegeszug antrat. Elektrisches Licht gibt es bis heute noch nicht in P. M., obwohl es mit Hilfe des Humorabaches nicht allzu schwer sein dürfte, ein kleines Elektrizitätswerk zu schaffen, das wenigstens für die frühen Abendstunden Licht spenden würde. In den Spinnstuben hörten die Kinder der Siedler von der deutschböhmischen Heimat, von der grossen Not am Anfang, und manche können heute noch die kleinsten Einzelheiten erzählen, die in solchen gemeinschaftlichen Stunden zur Sprache kamen.
Eine kleine Begebenheit, die sich gleich bei der Ankunft der Deutschböhmen in Rädäuti, abgespielt haben soll sei hier erwähnt: Einer der Kolonisten besass einen Hund, der zum Tabakholen abgerichtet war. Schon in Böhmen hatte das Tier seinem Herrn regelmässig die Botendienste in die Tabaktrafik getan. In Rädäuti wurde der Hund mit der neuen Trafik bekannt gemacht, und nach einiger Zeit schickte der Herr seinen Hund allein fort, den Tabak zu holen. Der Hund jedoch kehrte erst nach acht Tagen, zu Tode gehetzt, zurück er hatte den Tabak in Böhmen gekauft, wie er das schon jahrelang gewohnt war. Dem Päckchen lag ein Brief des böhmischen Kaufmanns bei mit vielen Grüssen und der verwunderten Frage, warum er denn nicht ein paar Zeilen durch den Hund überbracht habe – – –
Wer nicht arbeiten konnte, der hätte unmöglich in einer derartig primitiven Kolonie längere Zeit bleiben können. Und wer nicht entbehren gelernt hatte, der hielte es ebenfalls nicht lange aus. Der Verdienst der Leute war derart gering, dass man sich wundert, wie Menschen damit auskommen konnten. Der Verkauf von Pottasche, Schindeln und Resonanzholz, das man nach Österreich ausführte, brachte nur ein Weniges ein. Auf dem Tisch waren Mamaliga und Kartoffeln die hauptsächlich vorkommenden Speisen. Das Getreide, das zum Mahlen 24 km zur Mühle in Arbora gebracht werden musste, reichte nicht aus, dass die Hausfrau jeden Tag mit Brot aufwarten konnte. Im Sommer ersetzte ein Krug kühler Sauermilch den Wein und das Bier. Diese Einfachheit ist im allgemeinen bis heute beibehalten worden, und die Leute fühlen sich wohl und gesund dabei.
Der Väterglaube
Unsere Deutschböhmen haben die innige Frömmigkeit aus ihrer alten Heimat mitgebracht. In Böhmen zeugen die vielen Kapellchen und Wegkreuze von dem tiefen Glauben der Bewohner. So finden wir auch in Poiana M. zahlreiche Kapellen in den Gärten, vor den Häusern und am Rande der Strasse. Selbstgeschnitzte Kruzifixe, Statuen der Gottesmutter und anderer Heiligen stehen auf den Altärchen. Den ersten Gottesdienst hielten die Einwanderer Unter einer Fichte, an der ein religiöses Bild befestigt war. Da klangen zum ersten Mal die Gesänge der Heimatkirche und die von Kindheit an vertrauten Gebete zum Himmel. Manche Träne mag bei diesen ersten Gottesdiensten, wo die kleine Gemeinde ganz auf sich gestellt war, vergossen worden sein in schmerzlicher Sehnsucht nach der verlassenen Heimat. Aber sicher ist gerade in diesen Stunden auch wieder unendlich viel Trost in, die Herzen geflossen.
Die nett entstandene Gemeinde wurde pfarrlich Gurahumorului zugeteilt. Sobald die Gemeinde einigermassen aus dem Ärgsten heraus war, dachte man an den Bau einer Kirche. Es genügte den Leuten nicht, dass der Priester alle 1-2 Monate von Gurahumorului heraufkam, sie wollten den Priester unter sich haben. Bald stand eine einfache Holzkirche fertig da. Schon im Jahre 1850 reichten die Deutschböhmen ein Gesuch ein, dass man ihnen ihre Gemeinde zu einer Pfarrgemeinde machen solle. Der Priester Josef Szabo, der ein tief religiöser und selbstloser Mensch gewesen zu sein scheint, wirkte schon vor der Selbstständigkeit der Pfarrei unter den Deutschböhmen und Slowaken. Der Kaiser spendete auf eine Bitte hin 500 fl. zum Bau der Kirche. Im Jahre 1896 war die heutige Steinkirche, eine der sckmucksten Dorfkirchen unserer Bukowina, vollendet. Wir werden im nächsten Kalender eine ausführliche Geschichte der Pfarrei Poiana Micului aus berufener Hand bringen.
Raumnot
Poiana Micului, das anfangs 41 deutsche Familien zählte, wurde durch seinen Kinderreichtum bald zu einer stattlichen Gemeinde. Auf der anderen Seite aber bot das enge Tal keinerlei Raum zu einer weiteren Ausdehnung. Es trat das ein, was unsere Deutschböhmen seiner Zeit veranlasst hatte, ihre böhmische Heimat zu verlassen, die Raumnot. So kam es, dass viele, und ältere Leute zum zweiten Male ihre Sachen zusammenpackten und wieder zum Wanderstab griffen. Bosnien, Nordamerika und vor allem Brasilien war die neue Heimat der Auswanderer. Einige wenige suchten sich in Ostra drüben, in einem Seitental der Sucha einen Lebensunterhalt.
Kaum zehn Jahre sind es her, dass die Deutschböhmen aus Poiana Micului in Dumbrava im Altreich, hart and der Grenze der Bukowina, eine neue Kolonie geschaffen haben, deren Entstehungsgeschichte im Kalender 1936 genau beschrieben ist.
Ungefähr 12 Familien fuhren im Jahre 1887/88 mit anderen Bukowiner Deutschböhmen übers Meer. Nach, endloser Fahrt stiess man an die Küste Südamerikas. 50 Jahre sind seitdem vergangen, und die damaligen Siedler und ihre Nachkommen feierten voriges Jahr das 50. Jubiläum des Aufbaues der deutschen Kolonie Passa Tres.
Wir lesen darüber in der deutschen Zeitung, die in Curityba (Brasilien) erscheint in Nr. 78/1937 folgendes:
„Die erste Einwanderergruppe im Jahre 1887 bestand aus den Familien Johann Baumgärtner, Karl Schelbauer, Franz Schelbauer, Johann Schelbauer, Jakob Ranke und Johann Neuburger. Viele der alten Einwanderer aus den Jahren 1887 und 1888 leben heute noch und haben in voller Rüstigkeit an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilgenommen. Wir nennen hier nur einige Namen wie Jakob Fuchs, Ignaz, Josef und Ambros Schelbauer, Ignaz Maidl und andere, die weit und breit bekannt sind und überall einen guten Klang haben.
In rührender Verehrung hängen die Deutschböhmen an ihrem Glauben, an ihren alten Gebräuchen. Noch heute werden in den Familien alte Werkzeuge und Geräte aufbewahrt und in Ehren gehalten, die sie aus der Bukowina mit herübergebracht haben, noch heute verrichten sie ihre alten Gebete und singen sie die alten Kirchenlieder, die sie in der Bukowina lernten, und noch heute erweisen sie am Familientisch und an ihren Festtafeln den schmackhaften Bukowiner Gerichten die gebührende Ehre. Es ist ein kerniges deutsches Bauerngeschlecht, und man kann nur wünschen, dass sie auch in Zukunft allezeit so treu an ihrer kernigen, schlichten Art, an Glauben, Sprache und den guten schönen Vätersitten festhalten mögen.”
Volkstum
In Poiana Micului wird darüber richt gesprochen, sondern das Volkstum wird durch Taten bewiesen. Es ist eine alte Erfahrung, dass nur ein Volk, dass einfach lebt, fern jeder Überzivilisation der unnatürlichen Menschenzusammenballungen, die man Grosstädte nennt, noch die Kraft hat, das Volkstum in seiner ganzen Schönheit und Schlichtheit zu pflegen. Altes Brauchtum hat sich auch bei unseren Deutschböhmen mit den kirchlichen Festen innig verrankt. In bunter Manigfaltigkeit zieht so das Jahr dahin. Märchen und Sagen sind in dem stillen Tal zu Hause. Und selbst die kleinsten Kinder können wunderbar anschaulich in der so trauten deutschböhmischen Mundart erzählen. Auch in der Gegend, selbst entstandene Sagen werden mündlich weitergepflanzt.
Die Spinnstuben und die Unterhaltungen an den Sonntagnachmittagen bilden eine Art literarisches Büro, von wo aus derlei Dinge bis ins letzte Hans getragen werden. Der Deutschböhme singt für sein Leben gern. Das hat er den Vögeln des Waldes abgelauscht. Das Volkslied wird eifrig gepflegt. Und da hinten in Humoratal können sie noch richtig jodeln. Und sicher hat der Herrgott eine Freude an dem Christmettenjodler, den die Deutschböhmen am vorletzten Weihnachtsfest zum ersten Mal in der Kirche erklingen liessen. Wer nach PM kommt, sollte es nicht versäumen, den 86 Jahre alten Wenzel Hackl aufzusuchen, und ihn um den Vortrag eines Jodlers zu bitten. Er wird feststellen, genau wie die deutschen Studenten, die die Jodler und Volksweisen des Greises auf Schallplatten aufgenommen haben, dass das Alter dem Schmelz seiner Stimme nichts anhaben konnte.
Zum Schluss
Wir sind so langsam am Ende unserer Plauderei angekommen. Jeder der einmal in dem schönen Poiana Micului bei den Deutschböhmen gewesen ist, mit ihnen gegessen und mit ihnen an stillen Sonntagen geplaudert hat, muss dieses Völklein lieb gewinnen. Die Herzlichkeit und Einfachheit tut dem modernen Zivilisationsmenschen ganz gut. Und er kommt vielleicht bei vernünftigem Nachdenken darauf, dass es im menschlichen Leben nicht auf grosse Reichtümer ankommt, sondern auf die innere Zufriedenheit, auf das Gottvertrauen und auf die eigene Arbeit. Das lernen uns die Deutschböhmen durch ihre 100 Jahre alte wechse1vo11e Geschichte auf dem Boden der Bukowina und drüben in Amerika. Dass der Humor bei unseren Böhmerwäldlern ein gutbekannter Geselle ist, erfährt man bald, wenn man auch nur wenige Tage in Poiana Micului gewesen ist. Die Streiche der Burschen, die durchaus nicht die schüchternen Knaben sind, wie sie dem Fremden oft scheinen mögen, bilden oft wochenlang das Dorfgespräch in dem verlorenen Waldtal der Humora. Eine Probe dieses Humors sei unseren Lesern zum Schluss in dem Spruch des Hochzeitsladers vorgesetzt:
„I bin a geschickter Bot von Haus und Brautleutn, sie lossn eng rech sche bittn, grüasen, sollts morgn auf d’ Hautset kemma, auf en Trunk und auf en Sprung rundum um d’Stubn. Wos do nais sa wird, werds mitmocha, a Henn one Schwoaf, a Gons one Krogn, a Wurscht, wos neinmol um en Ofe umageht. Mei Stock ist zwoar schwoch bekleid, aber zum Dienst doch bereit. Er ist gestern kemma vo Wien, wenn sies mir net glaubts so glaubt es ihm! (dem Stock)” wh
